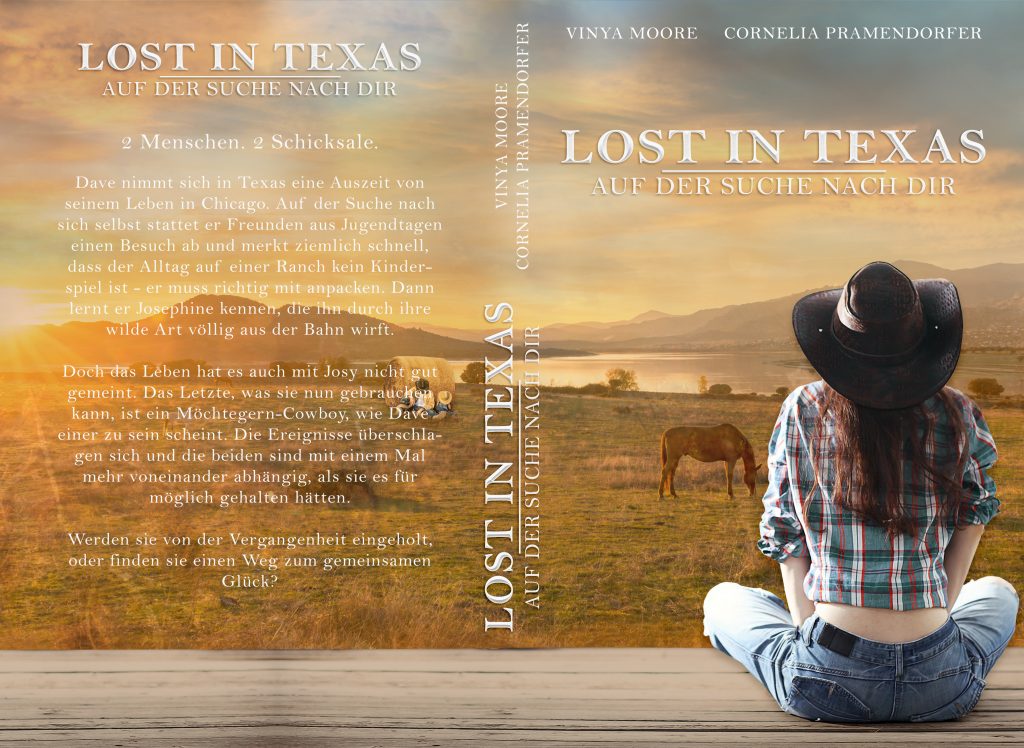
KAPITEL 1
Dave
»Marybeth! Hör auf, vor mir wegzulaufen.« Wie so oft in letzter Zeit versuchte sie, mir die Schlafzimmertür vor der Nase zuzuschlagen. Um das zu verhindern, hielt ich sie an den Schultern fest.
Seufzend drehte sie sich in meine Richtung. »Kannst du mich bitte einfach in Ruhe lassen?« So abgemagert, wie sie inzwischen war, konnte sie sich nicht einmal gegen meinen Griff wehren. Ihre grünen Augen hatten jeglichen Glanz verloren und nur die feinen Fältchen in ihrem Gesicht ließen erahnen, wie oft Marybeth gelacht hatte.
»Hast du mal in den Spiegel geschaut? Seit Wochen bist du nur noch ein Schatten der Frau, in die ich mich verliebt habe. Wir müssen endlich nach vorne schauen! Ich ertrage das alles so nicht länger!«, schrie ich aus voller Kehle. Ich schüttelte sie leicht und hoffte, sie würde endlich aus ihrer Starre erwachen.
Aber nichts geschah. Als ich bemerkte, was ich tat, ließ ich Marybeth sofort los und lief stattdessen kopfschüttelnd auf und ab. Mit den Fingern fuhr ich mir durch das zerzauste Haar, was meine Wut nicht mindern konnte. Verzweifelt wandte ich mich ihr zu. Sie stand schweigend an der gleichen Stelle und hatte sich keinen Millimeter bewegt.
Dass sie nicht einmal antwortete und mich nur stumm anstarrte, machte mich nur noch zorniger. Tränen rannen ihre Wangen hinab und trotzdem zeigte ihre Mimik keinerlei Gefühlsregung. Emotional abgestumpft hätte sie wohl am besten beschrieben.
Wie gerne hätte ich sie in den Arm genommen. Ihr sanft über das strähnige Haar gestreichelt und immer wieder geflüstert, dass alles gut werden würde, wenn wir endlich wieder an einem Strang zogen. Aber Marybeth ließ mich nicht an sich heran. Schon seit Monaten bekam ich sie kaum zu Gesicht. Die Schlaftabletten knockten sie aus und sie schlief fast den ganzen Tag.
Abgemagert bis auf die Knochen stand sie vor mir und weinte. Eine innerlich zerbrochene Frau. Ihre Miene regte sich nicht einmal, als ich sie anschrie.
Meine Hände auf ihrem Körper zu ertragen, kostete sie vermutlich alle Überwindung, die noch in ihrem schwachen Wesen schlummerte.
Wochenlang hatte ich sie nicht in den Arm genommen. Sobald ich versuchte, sie zu berühren oder ihr einen Kuss zu geben, hatte sie mich mit ihren dünnen Ärmchen weggedrängt. Ich vermisste sie und ich vermisste uns. Auch wenn es egoistisch klang, aber ich brauchte Marybeth genauso, wie sie mich.
Seit Tagen hatte meine Frau sich die Haare nicht gekämmt und die zuvor so glänzende Mähne, hing nun strähnig und ohne Form herab. Ihr Gesicht zeigte deutlich die Spuren der unzähligen Tränen, die sie in den vergangenen Monaten vergossen hatte. Geplatzte Äderchen färbten ihre Augen rot und tiefe Ringe zeichneten sich darunter ab. Sie hatte Ähnlichkeit mit einer Drogensüchtigen. Ich wusste, um ihren schlechten Zustand, sah aber keine Möglichkeit ihr zu helfen. Bei ihrem Anblick kam ich mir vor, wie ein Scheusal und bereute meine Worte beinahe. Was habe ich nur angerichtet?
Aber ich konnte meine Wut, meine Trauer und meine Verletzlichkeit nicht länger zurückhalten. Ich konnte nicht nur für sie da sein und ihr Fels in der Brandung sein. Ich brauchte ebenfalls ein Ventil. Doch Marybeth sah es nicht. Sie verstand meinen Zwiespalt nicht. Mit geballten Fäusten stürmte ich aus der Wohnung.
Die Nacht war bereits angebrochen und Dunkelheit umhüllte mich. Kälte kroch mir in die Glieder und kühlte mein erhitztes Gemüt allmählich ab. Ein Wohnhaus stand dicht gedrängt an das nächste. Sie türmten sich bis in den Himmel und säumten die Straße. Es wirkte erdrückend.
Ziellos lief ich durch die Straßen von Chicago, der Wind frischte auf und peitschte laut über die Dächer der Stadt. Heute machte sie ihrem Spitznamen »Windy City« alle Ehre. Bei dem Gedanken zwang sich mir ein Lächeln auf die Lippen, auch wenn mir nicht danach zumute war. Doch die Bezeichnung passte perfekt zu der Stadt, die ich in den vergangenen Jahren lieben gelernt hatte.
Ich war nach Chicago gezogen, weil Marybeth hier arbeitete, ihre Familie und ihre Freunde hier lebten. Nach jahrelangem Pendeln wollten wir nicht mehr getrennt voneinander leben. Für sie hatte ich meinen gut bezahlten Job zurückgelassen und gab mich mit einer ähnlichen Aufgabenstellung zufrieden. Nur bekam ich weniger Einkommen und musste längere Arbeitszeiten in Kauf nehmen. Ich vermisste meine großzügige Wohnung, mit den bodentiefen Fenstern und der phänomenalen Aussicht. Sie war nicht vergleichbar mit den vier Wänden, in denen wir jetzt wohnten.
Selbst meine Freunde hatte ich für sie verlassen. Ich hielt nur noch telefonisch Kontakt zu ihnen. Aber selbst das hatte ich für unsere Beziehung auf mich genommen.
Sie war die Richtige!
Zumindest hatte ich das die letzten acht Jahre angenommen. Aber jetzt? Ich wusste nicht, ob ich noch davon überzeugt war. Inzwischen hinterfragte ich alle meine Entscheidungen und dachte sogar darüber nach, zurück nach Miami zu gehen.
Ich vermisste die Sonne schmerzlich. Der Sommer in Chicago war nicht mit dem in Florida vergleichbar. Er war nicht heiß genug. Ohne die Sonnenstrahlen, die meine Haut kitzelten und sie gleichmäßig bräunten, fühlte ich mich wie eine Kalkwand kurz vor dem Abriss.
Ich stellte den Kragen der Jacke auf, um mich vor der aufkommenden Brise zu schützen. Der Winter stand bevor. Zwar nicht meine Lieblingsjahreszeit, aber ich mochte den Schnee. Als Kind waren meine Eltern und ich jedes Jahr zu Weihnachten zum Skifahren in den Norden gefahren. Sofort überkamen mich Erinnerungen an unzählige Schneeengel, die mein Dad und ich vor dem Haus gemacht hatten. Sie riefen ein Gefühl von Beständigkeit in mir hervor, das mir ein wenig Halt spendete.
Ziellos streifte ich durch die Straßen und Einsamkeit machte sich in mir breit. Ich hatte mich noch an keinem Punkt in meinem Leben so verloren gefühlt. Hier hatte ich zwar Freunde, doch das waren Verbindungen, die durch meine Frau entstanden waren. Sie waren nicht mit der Freundschaft zu vergleichen, die ich mit Brad und Tom hatte. Ich wusste nicht, was ich ohne sie gemacht hätte. Auch wenn sie mir eine Stütze waren, hätte ich sie gerne hier gehabt, um mit jemandem persönlich reden zu können. Bisher hatte ich es noch nicht geschafft, sie auf ihrer Ranch zu besuchen. Die beiden waren nach Chicago gekommen, als Marybeth und ich geheiratet hatten. Seitdem hatte ich sie nicht mehr gesehen.
Die Zwillinge hatten ein aufregendes Leben, eine Arbeit, die sie erfüllte. Mit dem Kauf der Ranch hatten sie sich einen Traum erfüllt.
Für mich hatte sich seit dem Studium nichts geändert. Meine Eltern hatten gewollt, dass ich Jura studierte. Sie wünschten sich für mich einen Beruf, der mir ein regelmäßiges Einkommen sicherte, egal wie schlecht die Wirtschaftslage auch war. Gegen ihren Wunsch fiel meine Wahl auf Betriebswirtschaftslehre. Extrem eintöniger Studiengang, aber es war das, was ich wollte.
Zum momentanen Zeitpunkt konnten wir es uns nicht leisten, mein Einkommen auch noch zu verlieren. Marybeth stand nicht mal auf. Sie lag den ganzen Tag völlig apathisch im Bett und ließ sich von der Dunkelheit, die sie umgab, vollkommen vereinnahmen.
Bevor ich ging, warf ich einen kurzen Blick ins Schlafzimmer, und wenn ich nach Hause kam ebenfalls. Für sie schien die Zeit stehen geblieben zu sein. Für mich hingegen gab es diese Option nicht. Ich musste funktionieren. Irgendeinen Anreiz finden, weiterzumachen und nicht alles hinzuschmeißen.
Nun musste ich mir eingestehen, dass die treibende Kraft in meinem Inneren verschwunden war. Jeglicher Grund, jeden Tag auf die Arbeit zu gehen, mich zusammenzureißen, und nach vorne zu blicken, war mir aus den Händen geglitten. Er war scheppernd zu Boden gefallen und in tausend kleine Teile zersplittert.
Das wilde Hupen der Autos, die versuchten sich durch die eng befahrenen Straßen zu schlängeln, blendete ich aus. Eine Angewohnheit, die ich mir in Miami angeeignet hatte. Selbst die Menschen, die mich auf meinem Weg anrempelten und dann wütend über meine Dreistigkeit schimpften, waren mir egal.
Das Wetter hatte angezogen und ein Gewitter kündigte sich an. In der Ferne vernahm ich das erste Donnergrollen und Sekunden später erhellte ein Blitz den Himmel und riss mich aus meinen Gedanken. Als ich mich umsah, stellte ich fest, dass ich den ganzen Weg zur Ace Bar, meiner Lieblingsbar, zurückgelegt hatte. Die Straßenlaternen beleuchteten den Beton in kreisrunden Abschnitten und die grelle Reklame über dem Eingang ließ mich für einen kurzen Moment die Augen schließen. Ein Drink wäre jetzt keine schlechte Idee. Den Kopf gesenkt, betrat ich das Lokal.
Eine Wand aus dichtem Zigarettenqualm schlug mir entgegen und nahm mir die Sicht. Noch dazu der Gestank von Schweiß und abgestandenem Bier. Angewidert rümpfte ich die Nase und brauchte einen Moment, bis mich der Mief einhüllte. Ich wusste nicht weshalb, doch irgendwie beruhigte er mich und ich fühlte mich willkommen. Nur wenige Holztische waren noch frei. Die perfekte Uhrzeit, um nach der Arbeit ein Feierabendbier zu genießen oder sich einfach mit seinen Kumpels zu besaufen.
Auf meinem Weg Richtung Bar, betrachtete ich meine Umgebung zum allerersten Mal mit anderen Augen. Die Wände wurden von dunkelbraunen Holzlatten verdeckt, die dem heruntergekommenen und erdrückenden Ambiente die richtige Stimmung verliehen. Der Kamin gegenüber des Tresens wirkte unpassend, fast schon deplatziert. Trotz allem gehörte er irgendwie dazu. An der Theke, griff ich nach dem letzten freien Hocker und bestellte ein Bier.
Donny war zu einer Art Seelenklempner für seine Stammkunden geworden. Er fragte nie, hörte aber bereitwillig zu. An meinem Tiefpunkt hatte er mich nach oben in seine Wohnung, zwei Stockwerke darüber, tragen müssen. Nachdem ich den Rausch auf seiner Couch ausgeschlafen hatte, reichte er mir mit den Worten: »Ich will die Geschichte dazu hören«, eine Tasse Kaffee.
Ich war dankbar für sein offenes Ohr. Er hatte mich nicht verurteilt, hatte nach meiner Erzählung keine unangenehmen Fragen gestellt. Donny war einfach da gewesen, als ich jemanden brauchte.
Marybeth hingegen … sie hatte nicht ein einziges Mal gefragt, wie es mir ging oder wie ich mit all dem zurechtkam. Ihre Trauer machte sie blind. Sie hatte eine Mauer um sich errichtet, die langsam mit ihr selbst verschmolz. Sie bemerkte nicht, wie sehr mich ihr Verhalten verletzte.
Während ich an meinem Bier nippte, ließ ich die letzten Wochen Revue passieren. Meine Frau brauchte mich, dessen war ich mir bewusst, aber ich brauchte auch jemanden. Sie war nicht in der Lage, mir die Stütze zu sein, nach der ich mich sehnte. Die mich den Blick auf das Wesentliche nicht verlieren ließ. So lange sie mich von sich stieß, konnten wir beide nicht das sein, was der jeweils andere brauchte.
Resigniert senkte ich den Kopf.
»Harter Tag?«, fragte Donny, der mit einem alten Lappen über die Theke wischte um Krümel und Getränkepfützen zu beseitigen, die andere Gäste hinterlassen hatten.
»Ist seitdem nicht jeder Tag ein harter Tag?«, entgegnete ich und fummelte an dem Etikett der Flasche herum.
»Marybeth schläft immer noch die ganze Zeit?«, fragte er und stützte sich mit den Händen auf der Anrichte ab. Abwartend blickte er mich an.
Ich nickte und er wusste, dass jedes weitere Wort zu viel wäre. Es blieb nicht bei einem Bier. Ich hatte, nach dem Vierten, aufgehört zu zählen. Der Alkohol wärmte mich von innen. Er betäubte den Schmerz in meiner Brust und ließ mich wenigstens für ein paar Stunden vergessen.
Irgendwann hatte Donny mir ein Taxi gerufen, wofür ich ihm dankbar war. Noch einmal wollte ich nicht, von ihm die Treppen hochgehievt werden.
Mehrmals verfehlte ich das Schlüsselloch. Als der Schlüssel über das Schloss schabte, erklang ein kratzendes Geräusch. Ich stütze mich mit einem Arm gegen die Tür, um nicht umzufallen. Fluchend lehnte ich für einen Moment den Kopf an den kühlen Rahmen. Mit zusammengekniffenen Augen erreichte ich mein Ziel. Das Schloss klickte.
Ich stolperte in die Wohnung und als ich das Licht einschaltete, fiel die Tür scheppernd ins Schloss. Es war mir in diesem Moment egal, ob ich Marybeth weckte oder nicht. Vermutlich hörte sie sowieso nichts. Die Schlaftabletten in Kombination mit den Antidepressiva, die der Arzt ihr verschrieben hatte, setzten sie völlig außer Gefecht. Selbst wenn ich mich neben sie legen würde, bekäme sie es nicht mit.
Stöhnend setzte ich mich auf die Couch, schnappte mir die Decke und schaltete den Fernseher ein. Ich ließ mich berieseln, bis ich müde die Augen schloss und in einen unruhigen Schlaf fiel.
KAPITEL 2
Josephine
Lautes Geklingel riss mich aus meinem wohlverdienten Schlaf und dröhnte in meinen Ohren. Die letzte Nacht hatte ich wieder einmal über all den Rechnungen und Briefen gebrütet, die sich seit Monaten auf der Anrichte stapelten. Allmählich wuchs mir alles über den Kopf. Das Geld, die Ranch und vor allem die fehlenden Kunden, um alles am Laufen zu halten. Gestern war es weit nach Mitternacht, als ich ins Bett ging und in einen tiefen, traumlosen Schlaf fiel.
Mit einer Hand tastete ich nach der Ursache des Lärms und spürte die glatte Oberfläche des Nachttischs unter meinen Fingern. Blind wie ein Maulwurf, streckte ich meinen Arm weiter aus, bis ich das kühle Metall meines Weckers auf der Haut fühlen konnte. Nur noch wenige Zentimeter, dann würde wieder Ruhe einkehren und ich hatte noch ein paar Minuten, um in den Kissen zu versinken. Ich versuchte, den Ausschaltknopf zu drücken, doch meine Finger rutschten ab. Scheppernd fiel das Teil zu Boden und hüllte sich augenblicklich in Schweigen. Endlich. Mein Arm sank zurück auf die Matratze, als ich auch schon Schritte näherkommen hörte.
»Mum, hast du nun den Nächsten kaputt gemacht?«, erklang die Stimme meines Sohnes vor der Tür.
Ich seufzte hörbar auf. »Nein Nash! Er ist bestimmt noch in Ordnung.«
»Hoffentlich. Sonst müssen wir eine Weckerfarm aufmachen.« Nash kicherte leise vor sich hin und ich wunderte mich mal wieder, wo Siebenjährige nur diese seltsamen Ideen fanden. Schlecht war sein Einfall nicht. Zumindest würde das unseren wöchentlichen Einkauf billiger machen.
Dieser kleine Klugscheißer.
Das Holz der alten Treppe, die in den Wohnbereich hinunter führte, knirschte bei jedem seiner Schritte. Er war auf dem Weg in die Küche.
Müde schlug ich die Decke zur Seite und angelte mit den Füßen nach meinen Hausschuhen. Im Pyjama schleppte ich mich träge in die Küche und als ich die Treppe hinunterkam, wandte er sich mir zu.
»Ach Mama!«, erklang es beinahe vorwurfsvoll aus seinem Mund.
»Was heißt hier, ach Mama?«, fragte ich und strich ihm über die Haare, die denselben kastanienbraunen Farbton hatten wie meine.
Nash verdrehte die Augen und duckte sich unter meiner Hand hinweg, um meinen Liebkosungen zu entkommen. Manchmal wünschte ich mir, er wäre wieder der kleine Junge, der jeden Morgen zu mir ins Bett kroch und sich in meine Arme kuschelte.
Er schnappte sich den türkisen Hocker, der unter der Theke stand, und schob ihn vor die Kochinsel. Geschickt angelte er nach einer Pfanne, die darüber baumelte. Nash stellte sie auf die Herdplatte, nahm die zwei Eier entgegen, die ich ihm reichte und schlug sie hinein.
Nachdenklich lehnte ich an der Kühlschranktür und betrachtete meinen Sohn, der unser Frühstück zubereitete. Es war noch nicht lange her, da standen wir jeden Morgen zu dritt in der Küche und bereiteten unsere Mahlzeiten gemeinsam zu. Jeder dieser Tage war erfüllt von Fröhlichkeit und Glück. Wir hatten unser gemeinsames Leben genossen.
Das Scheppern der Teller, die Nash aus dem Schrank nahm, riss mich aus meinen Gedanken. Langsam löste ich mich aus meiner Starre und half ihm das Essen auf der Theke zu arrangieren. Ich ließ mich neben ihm auf einem der Barhocker nieder und schob ihm den Brotkorb zu. Ein unwiderstehlicher Duft breitete sich in der Küche aus und entlockte meinem Magen ein deutliches Knurren.
Irgendwann würden wir unsere Mahlzeiten wieder an unserem Esstisch einnehmen, doch seit den Geschehnissen blieb er unbenutzt. Irgendwann bestimmt. Zumindest hoffte ich, dass Nash eines Tages so weit sein würde.
»Lass es dir schmecken, mein Schatz.«
***
Die Tür fiel hinter Nash ins Schloss, als er sich auf den Weg zur Schule machte und ich seufzte auf. Er versuchte so sehr, stark zu sein. Wir versuchten es beide. Er war doch erst sieben Jahre alt. Dies war kein Leben für einen kleinen Jungen. Es war meine Aufgabe, mich um ihn zu kümmern und nicht umgekehrt.
Von Tag zu Tag zweifelte ich mehr an mir selbst und an meinem Versprechen, die Ranch weiter zu führen. Ich wusste schon lange nicht mehr, wie mir das gelingen sollte. Unruhig trommelte ich mit den Fingerspitzen gegen mein Glas, während ich an der anderen Hand an den Fingernägeln knabberte. Eine Angewohnheit aus meiner Jugend, die ich mir vor langer Zeit abgewöhnt hatte. In stressigen Situationen kam sie wieder zum Vorschein.
Ich warf einen Blick auf den Stapel unbezahlter Rechnungen, der sich auf der anderen Seite der Theke auftürmte. Nervös biss ich mir auf die Unterlippe, als mir eine der unzähligen Mahnungen ins Auge fiel. Wie sollte ich das alles bezahlen? Unser Geld reichte nur für die nötigsten Dinge. Ich gab mein Bestes, um genug aufzubringen, doch jeden Tag entglitt mir dieses geliebte Leben mehr. Es rann mir durch die Finger, wie Sand in einer Sanduhr.
Seufzend erhob ich mich von dem Hocker, näherte mich den Briefen wie ein Raubtier seiner Beute. Nur war in diesem Fall ich die Gejagte.
Ich ordnete den Stapel nach Dringlichkeit und packte die beiden Obersten in meine Tasche. Die Uhr zeigte bereits halb acht und ich eilte nach oben ins Schlafzimmer, um mich anzuziehen. Als ich eintrat, blendete mich das grelle Sonnenlicht und schmerzte in meinen Augen. Schützend schirmte ich sie ab und wandte mich dem Kleiderschrank zu. Flink durchstöberte ich meine Shirts, entschied mich schließlich für ein pinkfarbenes Top mit Spitze am Dekolleté und schlüpfte in meine Lieblingsjeans.
Wieder in der Küche nahm ich die Tasche von der Stuhllehne und eilte zur Tür hinaus. Als ich einen stechenden Schmerz in meiner Fußsohle spürte, schrie ich auf. Fluchend stützte ich mich am Türrahmen ab und blickte an mir hinab. Wie so oft, an diesen warmen Tagen, war ich barfuß nach draußen gegangen. Langsam ließ ich mich zu Boden sinken und zog den Fuß näher, um einen besseren Blick darauf zu werfen. Ein langer Holzsplitter hatte sich in das empfindliche Gewebe gebohrt. Zum Glück stand noch ein Stück daraus hervor, somit würde ich keine Pinzette benötigen. Vorsichtig zog ich ihn heraus und betrachtete das kleine Loch, in dem sich bereits Blutstropfen sammelten. So wie es aussah, hatte ich nur diesen einen abbekommen. Humpelnd ging ich wieder nach drinnen und zog meine schwarzen Boots an. Das Leder war mit Blüten bestickt, die farblich perfekt zum Oberteil passten. Der Schmerz war nicht mehr so stark und würde bald ganz nachlassen.
Darauf bedacht nicht zu fest aufzutreten, machte ich mich auf dem Weg zum Wagen.
Schon von weitem sah ich die Beule in der Stoßstange, die unzählige Erinnerungen in mir weckte. Es war fast zehn Jahre her, dass ich nach Texas gezogen war. Eigentlich sollte es nur ein kurzer Aufenthalt werden, doch ich blieb für die Liebe.
Als ich das erste Mal in Chappell Hill eintraf, war ich mir sicher, vor Einsamkeit zugrunde zu gehen. Am meisten hatte ich Angst davor keine Freunde zu finden und diesen Umzug irgendwann zu bereuen. Doch genau das Gegenteil war der Fall. Es war unglaublich lebhaft, trotz der Einöde und vor allem war es vielfältig. Und ich entdeckte meine neue Leidenschaft. Die Liebe zu Cowboystiefeln. Ich musste sie einfach alle besitzen, ein Traum für jede Prinzessin auf dem Land. Denn genau so fühlte ich mich hier. Es gab keinen besseren Ort auf der Welt, als diese Ranch.
Mit der Handtasche über der Schulter band ich im Laufschritt meine Haare zu einem Pferdeschwanz und eilte auf das Auto zu. Ich ließ mich auf den Sitz meines roten Pick-ups fallen, der unter meinem Gewicht ächzte, drehte den Schlüssel, bis der Motor ansprang und das Auto unter mir erzitterte. Liebevoll tätschelte ich das Armaturenbrett und flüsterte: »Alles gut, mein Großer.« Als hätte er mich gehört, wurde das Geräusch gleichmäßiger und ich fuhr aus der Einfahrt.
***
Als ich auf dem Markt eintraf, hatte dieser bereits begonnen und ich war froh, dass ich gestern Abend noch die Kisten mit den Äpfeln der Späternte auf die Ladefläche gepackt hatte. Wäre ich später angekommen, hätten die meisten Kunden ihre Einkäufe erledigt und ich wäre auf meinem Obst sitzen geblieben. Den Pick-up parkte ich etwas abseits des Trubels und sprang aus dem Wagen.
Mit Schwung trat ich gegen den Sicherungsstift der Ladeklappe, um ihn zu lockern und besser aus der Verankerung lösen zu können. Mein Blick schweifte über den Markt.
Menschen drängten sich auf dem Platz, um ihre Wocheneinkäufe zu tätigen. Gedankenverloren löste ich den letzten Stift und vergaß die schwere Klappe festzuhalten. Mit lautem Getöse knallte sie nach unten. Erschrocken sprang ich zurück und wurde Sekunden später hochgehoben und herumgewirbelt. Mein bester Freund hatte beide Arme um mich geschlungen und lachte albern.
»Ethan, wenn ich einen Herzinfarkt kriege, bist du Schuld.« Um meinen Schrecken noch zu verdeutlichen, fasste ich mir ans Herz, das ziemlich raste.
»Auch schön dich zu sehen, Josephine.« Er zog einen Schmollmund und trat an den Wagen.
»Lachen Ethan. Sei nicht immer so ein alter Griesgram.«
Seit fast einem Jahr war er stets zur Stelle, wenn ich seine Hilfe benötigte. Ich war ihm unendlich dankbar für die Zeit, die er für mich und Nash aufbrachte und dabei meist sein eigenes Leben hinten anstellte. In seiner Nähe konnte ich meine Sorgen vergessen. Wenigstens für einen kurzen Moment.
Ich boxte ihn in die Seite und kletterte geschwind auf die Ladefläche, um mich hinter den Kisten zu verkriechen. Zu langsam. Er erwischte meinen Arm und zog mich mit Schwung zurück. Ein erschrockenes Quietschen drang aus meinem Mund. Ich taumelte, verlor das Gleichgewicht und stürzte. Ethan fing mich auf und setzte mich auf der Ladefläche ab. Lachend hockte ich dort und er grinste mich nur kopfschüttelnd an.
»Los an die Arbeit, Prinzessin. Danach gibt es einen leckeren Kakao.«
So etwas ließ ich mir nicht zweimal sagen. Voller Tatendrang schwang ich mich herunter und folgte ihm. Die nächsten Stunden verbrachten wir auf dem Marktplatz, um Geld in die Kasse zu bekommen. Immerhin warteten noch einige Rechnungen darauf, beglichen zu werden.
